
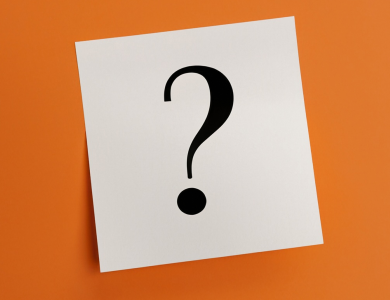
1. September 2025

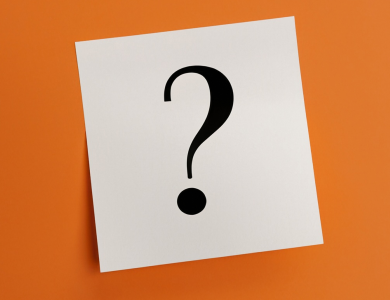
1. September 2025
01.September 2025
Auf einer Businessplattform habe ich tatsächlich 18 verschiedene Fragearten gefunden, die keinen Zweifel aufkommen lassen, wie verhängnisvoll Meetings für die Beteiligten sein können, wenn sie nicht gleich die richtige Antwort geben. Hier nur einige: Alternativfrage („Wollen Sie Lösung A oder B?“), Bumerangfrage („Was stört Sie an diesem Workflow?“), Einwandfrage („Welche Risiken sehen Sie?“), provozierende Frage („Warum sind Sie so ablehnend eingestellt?“). Meetings in meinem Lektorat oder online sind zum Glück völlig risikolos.
Zurück zu sprachwissenschaftlichen Kategorien. Eine Frage kann allein aus einem Wort wie „Hä?“ bestehen, das so mancher mit „Wie bitte?“ oder „Pardon?“ übersetzen würde. Oder die Frage ist als Satz ausformuliert: „Was steht im Rezept?“ Auch in Dialogen sind Fragen üblich: „Warum rufst du nicht zurück?“ Auf eine rhetorische Frage erwartet der Sprecher keine Antwort: „Warum muss ich das jetzt zum 100. Mal erklären?“ Die Suggestivfrage funktioniert ähnlich, legt aber eine Antwort nahe: „Das findest du doch auch?“ Hier soll das erhoffte „Ja“ folgen. Um diese Hoffnung noch stärker zu betonen, können Signalwörter wie „oder“ eingesetzt werden: „Das findest du doch auch, oder?“ Möglich wären nach einem Komma ebenfalls „nicht?“ oder „nicht wahr?“.
Es gibt außerdem Sätze, die eine Frage als Nebensatz enthalten und daher mit einem Punkt enden, so bei der indirekten Rede: „Er fragte, wann er kommen solle.“ Das Fragezeichen kann auch die Unsicherheit in Bezug auf eine Angabe ausdrücken, indem es in Klammern gesetzt wird: „Der Täter war 45 (?) Jahre alt.“ Oder die Frage ist zugleich als Ausruf gemeint: „Was fällt Ihnen ein?!“
Das Wort „Fragezeichen“ kommt zudem gerne in Redewendungen vor:
Bei Fragen spielen in der gesprochenen Sprache die Betonung und die Körpersprache eine besondere Rolle. Im Unterschied zu dem Aussagesatz „Du lernst gerne.“ klingt bei identischem Wortlaut, aber nun als Frage formuliert „Du lernst gerne?“ die Stimmlage am Ende höher. Zudem unterstreicht die Mimik mit hochgezogenen Augenbrauen oder der fragende Gesichtsausdruck eine nicht unbedingt ausgesprochene Frage. Noch deutlicher signalisieren nach oben gehaltene Handinnenflächen eine im Raum stehende Frage.
Anders als das viel später entstandene Ausrufezeichen: besser sparsam verwenden! geht das Fragezeichen auf das 8. Jahrhundert zurück. In Handschriften aus dem Umkreis der Hofschule Karls des Großen findet sich zunächst die Neume. Das ist ein grafisches Zeichen zur Notation einer Melodie und zur gewünschten Interpretation eines gregorianischen Gesangs. Es sieht aus wie ein Punkt mit einer diagonal geschlängelten Linie darüber. Es signalisierte einst dem Vortragenden, die Stimme zu heben – so wie der Klang bei einer Frage am Ende hochgeht. Wie die Neumen entstanden, ist unklar. Die ältesten bis heute überlieferten Handschriften, die Fragezeichen enthalten, stammen aus der französischen Benediktinerabtei Corbie und entstanden unter dem Abt Maurdramnus (772–781).